Die Visite
Als ich aufsah von meinem leeren Blatt,
stand der Engel im Zimmer.
Ein ganz gemeiner Engel,
vermutlich unterste Charge.
Sie können sich gar nicht vorstellen,
sagte er, wie entbehrlich Sie sind.
Eine einzige unter fünfzehntausend Schattierungen
der Farbe Blau, sagte er,
fällt mehr ins Gewicht der Welt
als alles, was Sie tun oder lassen,
gar nicht zu reden vom Feldspat
und von der Großen Magellanschen Wolke.
Sogar der gemeine Froschlöffel, unscheinbar wie er ist,
hinterließe eine Lücke, Sie nicht.
Ich sah es an seinen hellen Augen, er hoffte
auf Widerspruch, auf ein langes Ringen.
Ich rührte mich nicht. Ich wartete,
bis er verschwunden war, schweigend.
Quellenangabe:
Enzensberger, Hans Magnus. Kiosk. Neue Gedichte. Frankfurt/M 1995 (Suhrkamp), S. 118-119.
Interpretation:
Plötzlich - und zwar in einer Zeit des Anfangs, in der die unmittelbare Zukunft noch ganz ungewiss ist - und überfallsartig beginnt die Konfrontation: "
Als ich aufsah von meinem leeren Blatt, / stand der Engel im Zimmer."
Wie in der biblischen Erzählung so zielt auch bei Enzensberger der Angriff auf Vernichtung und verstärkt die im leeren Blatt bereits angedeutete Leere. Die Rede des Engels zeigt dem lyrischen Ich seine Entbehrlichkeit in vier Vergleichen: Er beginnt mit dem Spektrum der Farbe Blau, führt dann über ein häufig vorkommendes Mineral (den Feldspat), eine Galaxie (die große Magellansche Wolke) bis zu einer häufig vorkommenden Sumpfpflanze (dem gemeinen Froschlöffel). Alle Vergleiche, egal aus welchem Bereich sie genommen werden, verwenden Vergleichsspender, die eine sehr große Verbreitung und entsprechend einen eher geringen Wert haben. Wenn all diese Dinge, so die Rede des Engels, wesentlich unentbehrlicher sind als das lyrische Ich, unterstreicht dies die Aggressivität, mit der das Ich mit seiner (angeblichen) Bedeutungslosigkeit konfrontiert wird. Die Körperlichkeit der Auseinandersetzung, wie es die biblische Erzählung schildert, wird im Gedicht nicht aufgegriffen. Der Ringkampf wird im Medium der Sprache eröffnet, wobei die naturwissenschaftlich exakte Sprache der Auseinandersetzung die Distanz vergrößert und durch den Überraschungseffekt, den diese Sprachwahl im Mund eines Engels bewirkt, zugleich ironisch bricht. Bevor eine Reaktion des lyrischen Ichs geschildert wird, folgt zunächst die Einschätzung der Situation:
"Ich sah es an seinen hellen Augen, er hoffte / auf Widerspruch, auf ein langes Ringen."
An dieser Stelle wird die biblische Erzählung von Jakobs Kampf als Deutung der Situation eingespielt und angezeigt, dass das lyrische Ich die Begegnung als Herausforderung erkennt. In der biblischen Vorlage ist Ziel der Begegnung die Auseinandersetzung selbst. Es ist das Ringen um eine Perspektive, die es so noch nicht gibt, und die auch nicht vom Engel einfach mitgeteilt wird. Vielmehr muss sie erst errungen und erkämpft werden. Im Gedicht allerdings wird dieses Motiv auf einen Wunsch des Engels reduziert und damit dem lyrischen Ich ein Handlungsspielraum eröffnet. So bricht die im Folgenden geschilderte Reaktion mit der biblischen Vorlage und verweigert die Auseinandersetzung:
"Ich rührte mich nicht. Ich wartete, / bis er verschwunden war, schweigend."
Damit endet die Vision. Zwei Unterschiede zur biblischen Erzählung werden damit besonders deutlich: Es findet kein Kampf statt und der Engel lässt auch keinen Segen zurück. Obwohl das Ringen mit dem Engel nicht Teil der erzählten Vision ist, fällt es nicht einfach weg, sondern es findet vielmehr im Gedicht selbst, als poetologische Reflexion, statt. Ähnlich verweist der schweigende Engel darauf, dass ein Segen nicht erzählt, nur errungen werden kann. Dies ist ebenfalls im Gedicht selbst der Fall, und am Ende des Ringens, das vor einem leeren Blatt begann, steht ein Gedicht. Die Vision wird so zur metaphorischen Schilderung des Ringens im Gestaltungsprozess, die Engelfigur dient als Alter Ego, das in Frage stellt, in dem die Zweifel Gestalt annehmen, aber auch überwunden werden bzw. es kann deren Verschwinden abgewartet werden.
Quellenangabe:
Aus: "Sie reden die Luft zwischen den Wörtern" (Härtling). Biblisch-lyrische Gespräche über Engel von Prof. Susanne Gillmayr-Bucher (KTU Linz) erstmals erschienen in: Mitteilungen aus dem Brenner-Archiv 30 (2011), 55-67.

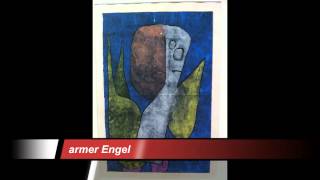


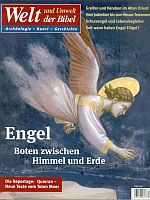




![Zeitungsverkäufer am Graben in Wien, Link zum Foto: //commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeitungsverkauf_Wien_Kolporteur_Kronen_Zeitung_2014_01.jpg / © von Joadl (Eigenes Werk) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) oder CC BY-SA 3.0 at (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en)], via Wikimedia Commons Zeitungsverkäufer am Graben in Wien, Link zum Foto: //commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeitungsverkauf_Wien_Kolporteur_Kronen_Zeitung_2014_01.jpg](/storage/img/3e/70/asset-36e27edc00b6d1d9bd1b.jpg)











