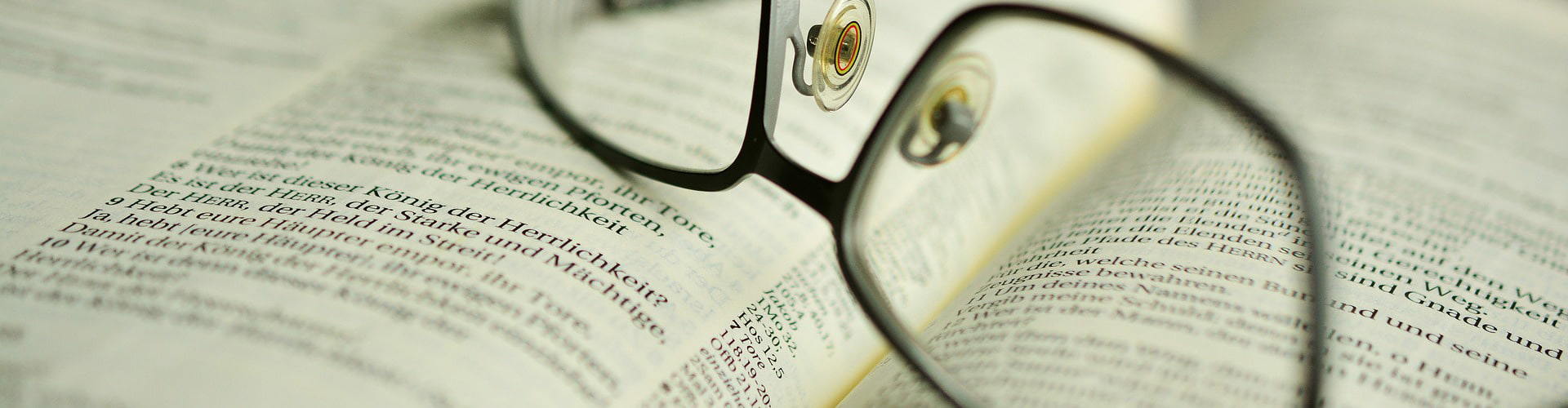Texte der Osternacht
Die Versammlung inmitten der nächtlichen Dunkelheit rund um das entzündete Osterfeuer ist wie ein Vorzeichen über alles Folgende.
Im Segensgebet wird dankbar auf das Feuer geschaut, das die Nacht erhellt.
Im Schein dieses Feuers erkennen die Feiernden den auferstandenen Christus, das Licht der Welt, das in der Taufe zur innersten Lebenswirklichkeit von uns Menschen geworden ist. Das Licht der Osterkerze verschenkt sich an jede und jeden einzelnen, erhellt den Feierraum. Mit diesem Zeichen vor Augen wird im Exsultet das Erlösungswerk gepriesen, das Aufleuchten des göttlichen Lichtes in Jesus Christus. In ihm kommt zum unüberbietbaren Höhepunkt, was Gott von Anfang an zum Heil der Menschen gewirkt hat.
Wort-Gottes-Feier
Und genau das betrachten und feiern die Versammelten im anschließenden Lesegottesdienst, der aus sieben Abschnitten aus dem ersten Teil der Heiligen Schrift (Altes Testament) besteht und denen jeweils Psalmengesang und eine abschließende Gebetsstille folgen, die durch eine Oration beschlossen wird. Die Kirche hält auf diese Weise eine Vigil, eine Nachtwache für den Herrn, in der ihr die österliche Lichtspur erschlossen und vergegenwärtigt wird, die mit dem Schöpfungshandeln Gottes beginnt und die im Christusereignis ihre Erfüllung findet. Auf diese Weise soll neu ins Herz der Menschen dringen, dass Gott treu zu allem Leben steht und diese Treue in Jesus Christus endgültig erwiesen hat.
Die Liebe Gottes ...
Deshalb beginnt der Lesegottesdienst mit dem ersten Abschnitt aus dem Buch Genesis (Gen 1,1–2,2), in dem sich zeigt, dass die erste Tat Gottes darin besteht, dass er dem Chaos und der Finsternis entgegen tritt und Licht schafft, in dem sich das Leben entfalten kann.
Die zweite Lesung aus dem Buch Genesis (Gen 22,1–18) schließlich führt in unbeschreiblicher Dramatik vor Augen, wie geheimnisvoll und widersprüchlich Gott in den Augen der Menschen erscheinen kann. Mit der Aufforderung an Abraham seinen Sohn Isaak als Opfer darzubringen, scheint Gott seiner Verheißung untreu zu werden. Doch Gott selber greift im letzten Augenblick ein und macht so deutlich, dass er zum Leben steht, selbst dort, wo er in den Augen der Menschen als fremd und unbegreiflich wahrgenommen wird.
Die dritte Lesung schließlich hat den Auszug des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei zum Inhalt (Ex 14,15–15,1). Im Durchzug durch das Rote Meer rettet Gott sein erwähltes Volk aus der Unterdrückung in die Freiheit. Der Name „Ägypten“ steht dabei für alles Bedrohliche und Todbringende, das Gott in den Fluten zugrunde gehen lässt. Er stellt sich damit abermals auf die Seite des Lebens und verhilft ihm zur Entfaltung in Freiheit und Würde.
Die vierte Lesung (Jes 54,5–14) zeigt ungeschminkt, dass menschliches Leben auf vielerlei Weise in die „Fremde“ geraten kann und dann in die große Frage einmündet: Wird Gott auch trotz aller Untreu unsererseits zu uns stehen? Erreicht uns sein Licht auch dann noch, wenn wir uns in äußerster Finsternis verirrt haben? Der Prophet Jesaja verkündet vor dieser Grundfrage: Gott ist und bleibt verliebt in sein Volk und wird nie von ihm ablassen, was immer auch geschehen mag.
... als Quelle unseres Lebens
In der fünften Lesung (Jes 55,1–11) schließlich wird diese Liebe Gottes zum Menschen in ein wunderbares Bild gekleidet: Der Prophet Jesaja erinnert daran, dass Gott geradezu verschwenderisch ist mit seiner Zuwendung. Ohne jegliches Verdienst lädt er zum Fest des Lebens ein, schenkt er Anteil an seinem Leben.
Die sechste Lesung (Bar 3,9–15.32–4,4) schließlich stellt Gott als den vor Augen, der sein Volk nicht nur in die Freiheit und ins Leben führt, sondern ihm seine Weisung mitteilt, damit es nie mehr in die alte Abhängigkeit zurückfällt. Die Weisung Gottes ist die Quelle des Lebens.
Und schließlich zeichnet die siebte Lesung (Ez 36,16–17a.18–28) in einem sprechenden Bild das Verhältnis Gottes zu seinem Volk: Gott will die Verwandlung des Menschen. Er nimmt das Herz aus Stein aus seiner Brust und schenkt ihm ein Herz aus Fleisch. Er bildet das Herz der Menschen dem seinen nach. Er will zur innersten Lebenswirklichkeit werden.
Eintauchen: durch die Taufe
Und genau das geschieht mit einem Menschen in unüberbietbarer Art und Weise in der Feier der Taufe. Davon gibt die nachfolgende Lesung aus dem Neuen Testament – Röm 6,3–11 – Zeugnis: In seiner „Taufpredigt“ erinnert der Apostel Paulus daran, dass wir ganz in das Lebensschicksal Jesu Christi – in seinen Durchgang vom Tod zum Leben – eingetaucht und ihm gleichgestaltet wurden.
Auftauchen: in ein neues Leben
Die Treue Gottes, die selbst im Tod nicht bricht, wird in der Taufe zur innersten Lebenswirklichkeit. Weil Gott in seiner Treue Jesus Christus aus dem Tod errettet hat (Botschaft des Evangeliums), geht sein Leben auch auf alle über, die sich in der Taufe in ihn hinein verankern. Die österliche Lichtspur, die mit der Schöpfung beginnt und in der menschlichen Geschichte immer wieder zum Leuchten kommt, vollendet sich schließlich an und in allen, die in der Taufe zu einer „neuen Schöpfung“ werden.
Die vielen Bilder und Verheißungen der Lesungen verdichten sich so an jenen, die in der Osternacht getauft werden und in diesem Zeichen in die Liebe Gottes eintauchen. Weil Gott treu ist, wird er das, was wir im Zeichen vorwegnehmen, am Ende des Lebens einlösen, wenn wir sterbend erwachen in seinem Licht. Der Durchgang durch die Osternacht will uns in dieser Hoffnung stärken.
Text: Josef Keplinger, Referent im Liturgiereferat des Pastoralamtes der Diözese Linz und Kurat in der Dompfarre Linz.