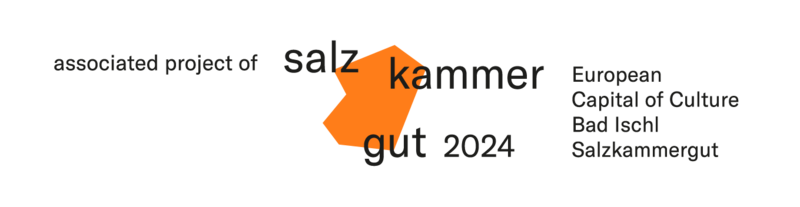Viel Herz und viel Schmerz

Mit großer Herzenswärme begegnen Besucherinnen und Besucher von Nah und Fern dem Bad Ischler Kalvarienberg. Das ergab eine Befragung vor Ort im vergangenen Winter. Und doch erzählt jener zugleich auch eine schmerzhafte Geschichte von Gewalt und Ausgrenzung: des Judentums und von evangelischen Christinnen und Christen.
 Traditionell steht der Kalvarienberg mehr für einen Glauben, der demütigt als auferbaut. Ein Studientag der Pfarre Bad Ischl und des Büros für Kirchliche Projekte zum Kulturhauptstadtjahr versuchte zu Christi Himmelfahrt, sich dieser Spannung interdisziplinär anzunähern, ein Referenzprojekt für Salzkammergut 2024.
Traditionell steht der Kalvarienberg mehr für einen Glauben, der demütigt als auferbaut. Ein Studientag der Pfarre Bad Ischl und des Büros für Kirchliche Projekte zum Kulturhauptstadtjahr versuchte zu Christi Himmelfahrt, sich dieser Spannung interdisziplinär anzunähern, ein Referenzprojekt für Salzkammergut 2024.
Gesamtkunstwerk Kalvarienberg: Bilder, Lieder, Gebete, Prozessionen
Der katholische Historiker Wilhelm Remes und Günter Merz, Mitarbeiter des Evangelischen Museums Oberösterreich, stellten die Kalvarienberge als planvoll eingesetztes Medium der Jesuiten vor, um das protestantische Salzkammergut wieder zum katholischen Glauben zu führen. Aus jener Epoche der Gegenreformation sind volkstümliche Lieder und Andachten erhalten, die das Leiden Christi in drastischen Worten nacherzählen. Der nachdrückliche Blick auf die Passion Jesu sollte den Gläubigen die eigene Schwäche und Sündhaftigkeit vor Augen führen.
Die Fremdenführerin Katharina Steinkogler erschloss die kunstgeschichtliche Dimension des Kalvarienbergs. Der Religionspädagoge Martin Jäggle zeigte, wie ein traditionelles Verständnis der Passion Christi Schuldgefühle verbreite und Menschen klein und ängstlich zurücklasse; dagegen plädierte er, die Berufung durch die Taufe in den Vordergrund der Glaubenspraxis zu stellen.
Bibel ist kein Protokoll
Der Bibelwissenschaftler Oliver Achilles führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Studientags die antijüdische Schlagseite der biblischen Passionserzählungen vor Augen. Die Überlieferung der Evangelien sei nicht als Bericht oder Protokoll nach heutigem Verständnis zu bewerten. Pontius Pilatus als Verantwortlicher für die Hinrichtung Jesu werde in den Passionserzählungen geschont; stattdessen seien innerjüdische Auseinandersetzungen des ersten Jahrhunderts bis heute äußerst wirkmächtig. Die Theologin Eva Harasta stellte Gedanken von Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer und Jürgen Moltmann vor, wie die Erfahrung des Kreuzes Jesu auf der Suche nach Sinn und Halt heute berühren und tragen könne. Das Kreuz sei als Zeichen des Mit-Leidens Gottes mit den Leiden der Menschen zu verstehen, mit der existenziellen Not auch der Gottverlassenheit und der Hoffnung auf Auferstehung.

Ob traditionelle Auslegungen der Passion Christi aktualisiert werden könnten und sollten, um auch heute noch relevant für den Glauben zu sein, oder ob es besser sei, diese endgültig im theologischen Museum zu verwahren, wurde beim Symposion engagiert diskutiert. Tatsache ist jedenfalls, dass das Brauchtum von Blut- und Gewalt in der heutigen Praxis von Gottesdienst und Begegnung auf dem Ischler Kalvarienberg keinen Platz mehr einnimmt. Der interreligiöse Friedensplatz, der dort jüngst entstanden ist, gibt diesem Ort eine neue Richtung im Geist von Vielfalt und Dialog.
Ilse Zierler, stellvertretende Obfrau des Pfarrgemeinderats Bad Ischl, zieht Bilanz: „Dieser Studientag war ein wichtiger Impuls für unsere Pfarrgemeinde und darüber hinaus. Er trägt sicher dazu bei, sich sensibler mit den Texten der Heiligen Schrift im Hinblick auf antijudaistische Tendenzen auseinanderzusetzen und hilft uns, die evangelische Geschichte besser zu verstehen.“ Auf den Kalvarienbergen des Salzkammerguts werde exemplarisch erfahrbar, wie traditionell ausgrenzende Lehren der katholischen Kirche überwunden werden und sich in eine Wertschätzung des Anderen und in eine Haltung des Hinhörens wandeln können. Wegen dieser Besonderheit wird auch die kommende Jahrestagung 2024 des „Internationalen Rats der Christen und Juden“ in Bad Ischl Station machen.